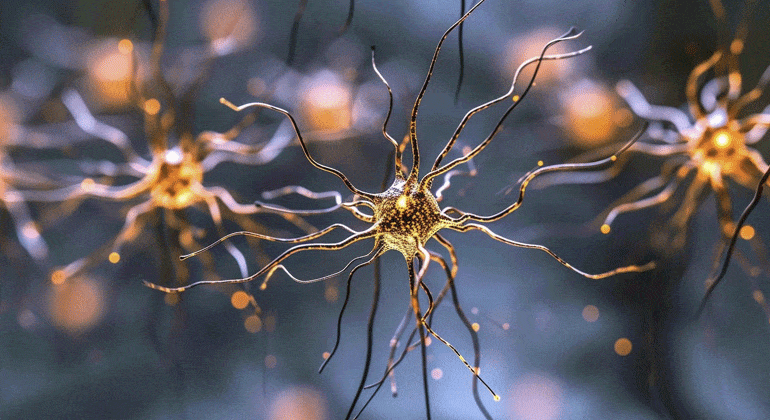
Was die Entdeckung der japanischen Forscher über Long-Covid verrät – und welche Perspektiven sich daraus für künftige Therapien und die Anwendung Transkranielle Pulsstimulation (TPS) ergeben
Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme, verlangsamtes Denken – viele Long-Covid-Patienten beschreiben das Gefühl, als sei ihr Kopf in Watte gepackt. Dieser „Brain Fog“ gehört zu den häufigsten und belastendsten Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Weltweit leiden laut Schätzungen mehr als 400 Millionen Menschen an Long-Covid, viele von ihnen an anhaltenden kognitiven Einschränkungen. Trotz unzähliger Studien blieb bislang unklar, was im Gehirn dieser Patienten tatsächlich passiert – bis jetzt.
Das Rätsel des Brain Fog – entschlüsselt mit moderner Bildgebung
Ein Forscherteam um Prof. Takuya Takahashi von der Yokohama City University (Japan) hat nun im Fachmagazin „Brain Communications“ erstmals gezeigt, dass sich im Gehirn von Long-Covid-Betroffenen bestimmte Nervenrezeptoren übermäßig vermehren – sogenannte AMPA-Rezeptoren (AMPA steht für α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure – diese Rezeptoren sind Bindungsstellen für den Botenstoff Glutamat, die das Lernen und Denken steuern). Diese Moleküle befinden sich auf den Synapsen, also den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, und steuern dort die Weiterleitung von Reizen über den Botenstoff Glutamat.
Mit einem neu entwickelten PET-Verfahren ([¹¹C]K-2 AMPAR-PET) konnten die Forscher diese Rezeptoren im lebenden Gehirn sichtbar machen. Das Ergebnis: Bei allen untersuchten Long-Covid-Patienten war die Dichte dieser AMPA-Rezeptoren im gesamten Gehirn deutlich erhöht. Diese Überaktivität könnte zu einer Art „Kurzschluss im Denkzentrum“ führen – einer dauerhaften Übererregung der Nervenzellen, die wiederum die Informationsverarbeitung behindert.
Brain fog: Wenn Reizüberflutung Denken blockiert
Normalerweise sorgt ein fein austariertes Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung – die sogenannte E/I-Balance (Excitation/Inhibition) – dafür, dass das Gehirn klar und geordnet arbeitet. Wird diese Balance jedoch gestört, etwa durch zu viele aktivierte AMPA-Rezeptoren, können die Signale nicht mehr präzise gefiltert werden. Das Gehirn arbeitet dann mit einem deutlichen belastenden „Hintergrundrauschen“, ähnlich wie ein Radio mit zu starkem Empfangspegel: Das Signal ist da, aber sehr verzerrt.
Die Forscher vermuten daher, dass chronische Entzündungen nach einer SARS-CoV-2-Infektion diesen Zustand fördern. Bestimmte Entzündungsbotenstoffe (Zytokine), insbesondere TNF-α und TNFSF12, standen in der Untersuchung in direktem Zusammenhang mit der erhöhten AMPA-Rezeptordichte. Damit liefert die Studie erstmals eine biologische Erklärung für den Brain Fog, der so viele Long-Covid-Betroffene quält.
Potenzielle diagnostische Möglichkeiten – und therapeutische Ansätze
Das japanische Team spricht von einem potenziellen „biochemischen Fingerabdruck“ bei Long-Covid. Die PET-Aufnahmen erlaubten es, Long-Covid-Patienten mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent von Gesunden zu unterscheiden. Die Anzahl der AMPA-Rezeptoren könnte somit künftig als biologischer Marker dienen, um die Diagnose zu objektivieren und Therapien gezielter zu steuern.
Langfristig könnte auch eine pharmakologische Regulierung dieser Rezeptoren – etwa durch AMPA-Antagonisten wie Perampanel (ein Wirkstoff, der überaktive Glutamatrezeptoren bremst und ursprünglich als Epilepsie-Medikament entwickelt wurde) – neue Behandlungswege eröffnen. Doch noch steckt die Forschung in den Anfängen, und weitere klinische Studien sind nötig, um die Erkenntnisse in therapeutische Strategien zu übersetzen.
Was die Ergebnisse für Hirnstimulationsverfahren wie die Transkranielle Pulsstimulation (TPS) bedeuten könnten
Auch für Ärzte, die bereits mit der Transkraniellen Pulsstimulation (TPS) arbeiten, sind die neuen Erkenntnisse hochinteressant. Denn auch bei Long-Covid-Patienten mit Brain Fog wird in der Praxis beobachtet, dass sich die geistige Klarheit nach einer TPS-Behandlung deutlich verbessert.
Die Transkranielle Pulsstimulation (TPS) nutzt bekanntlich niedrigenergetische Stoßwellen-Impulse, die gezielt ins Gehirn übertragen werden. Über einen Mechanismus namens Mechanotransduktion (siehe hierzu auch: Mechanotransduktion und ihre Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen) werden dabei Nervenzellen stimuliert, Entzündungsprozesse moduliert und die Bildung neuer synaptischer Verbindungen (Synaptogenese) angeregt. Studien konnten zeigen, dass TPS sowohl die Durchblutung als auch die neuronale Aktivität in tiefen Hirnregionen verbessert – genau in jenen Arealen, die auch bei Long-Covid häufig betroffen sind.
Daraus ergibt sich ein schlüssiger Zusammenhang: Wenn der Brain Fog durch eine Fehlregulation der Glutamat-Signalwege entsteht, könnte eine sanfte Normalisierung der neuronalen Aktivität – wie sie durch die TPS beobachtet wird – helfen, die E/I-Balance wiederherzustellen.
TPS: Praxisbeobachtungen bestätigen den Forschungsansatz
In mehreren Kliniken und Praxen berichten Ärzte, darunter auch Dr. Markus Böbel aus Reutlingen, von hohen Erfolgsraten bei Long-Covid-Patienten mit neurologischen Symptomen. Rund 80 Prozent der Behandelten erleben demnach eine deutliche Verbesserung ihrer Konzentrationsfähigkeit, Denkgeschwindigkeit und Belastbarkeit – häufig schon nach wenigen Sitzungen (siehe hierzu auch: Long-Covid: Langzeitfolgen von COVID-19 und die Behandlung mit TPS).
Auch Priv.-Doz. Dr. med. Erasmia Müller-Thies-Broussalis, MSc, leitende Neurologin und Radiologin an der renommierten EMCO-Klinik in Bad Dürrnberg, Salzburg, Österreich, berichtet über ähnliche Beobachtungen. In ihrem Institut für Neuropsychiatrie, Psychosomatik und Gesundheitsvorsorge setzt sie die TPS gezielt bei Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-Syndrom ein.
Sie beschreibt die Methode als „hervorragendes Modul zur Förderung der Neuroplastizität“ – also jener Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu regenerieren und neue Verbindungen zu schaffen.
Müller-Thies-Broussalis betont, dass viele Betroffene nach wenigen Sitzungen eine deutliche Aufhellung des Denkens und eine Zunahme geistiger Klarheit erfahren: „Die TPS ist bei Post-Covid- bzw. Neuro-Covid das Mittel der Wahl, um Patienten in der Genesung zu unterstützen. Der Erfolg ist beeindruckend.“ (siehe hierzu das Interview: Priv.-Doz. Dr. Erasmia Müller-Thies-Broussalis über die TPS-Therapie)
Wissenschaftlich belegt und erklärt ist dieser Zusammenhang freilich noch nicht, aber die klinische Erfahrung zeigt: Das Abklingen des Brain Fog nach TPS deckt sich auffallend gut mit dem, was die japanische Studie auf molekularer Ebene beschreibt – nämlich einer überreizten Synapsen-Aktivität, die wieder „in Takt gebracht“ werden muss.
Ausblick: Von der Molekülforschung zur funktionellen Therapie
Noch steht die Forschung zu Long-Covid am Anfang, es gilt noch viele Puzzle-Teilchen zusammenzufügen. Doch die Studie aus Yokohama hat das Verständnis des Brain Fog grundlegend verändert: Der „Nebel im Gehirn“ ist kein diffuses Phänomen mehr, sondern Ausdruck messbarer, reversibler Veränderungen an den Synapsen.
Genau hier könnte die Zukunft liegen – in einer Kombination aus molekularer Diagnostik und funktioneller Hirnstimulation. Was heute noch als Hypothese gilt, könnte schon bald klinisch überprüft werden. Für Betroffene, die oft über Monate im Nebel leben, ist das ein Hoffnungsschimmer: Das Gehirn ist kein statisches Organ, sondern lern- und heilfähig – und Verfahren wie die TPS zeigen längst, dass diese Plastizität therapeutisch nutzbar ist.
Quelle:
https://academic.oup.com/braincomms/article/7/5/fcaf337/8258475

